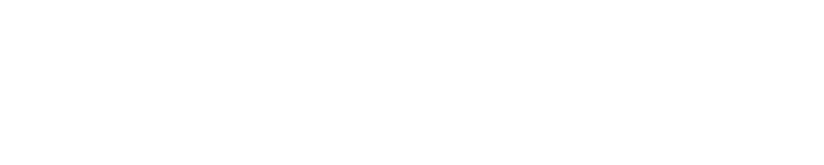26.02.2026
19:18 | Du bist nackt... Dein Smartphone ist offen – Für jeden, der zahlen kann...
Siehe auch Edward Snowden Permanent Record
Man hat praktisch nichts mehr, was wirklich privat und verborgen ist. Viele denken, künstliche Intelligenz sei erst seit Kurzem ein großes Thema – seit ChatGPT und Co. richtig bekannt wurden. Doch Regierungen und Geheimdienste nutzen die KI schon seit vielen Jahren, teilweise seit über 15 Jahren intensiv. Das gibt Ländern wie den USA, China oder Russland einen riesigen Vorsprung, den die meisten Menschen gar nicht richtig einschätzen.
Der große Datendiebstahl durch China
China hat 2015 beim sogenannten OPM-Hack die Personaldaten von über 21 Millionen US-Regierungsmitarbeitern gestohlen. Betroffen waren vor allem aktive und ehemalige Soldaten, Geheimdienstler und Beamte, aber auch deren Familien und Bekannte. Gestohlen wurden extrem sensible Daten: Sozialversicherungsnummern, Fingerabdrücke (von 5,6 Millionen Menschen), Adressen, Finanzinformationen, detaillierte Lebensläufe aus Sicherheitsüberprüfungen (SF-86-Formulare), Angaben zu Familie, Freunden, Auslandsreisen und sogar psychologische Informationen. Diese Daten sind Gold wert für Spionage, Erpressung und langfristige Geheimdienstoperationen. Der Hack wurde weitgehend China zugeschrieben – speziell dem Ministerium für Staatssicherheit und der Jiangsu State Security Department. Es gab Verhaftungen (z. B. eines Chinesen wegen der verwendeten Malware) und offizielle US-Aussagen, die China verantwortlich machten.
TikTok sammelt massenhaft Daten
Es hat Hunderte Millionen Nutzer weltweit. Die App sammelt extrem viele Informationen: Standortdaten, Kontakte, Fotos, Videos und sogar, was man in der App tippt. Forscher haben gezeigt, dass der eingebaute Browser von TikTok Tastatureingaben mitliest – also auch Passwörter, Kreditkartennummern oder andere sensible Texte. Da TikTok zu einem chinesischen Unternehmen gehört und chinesische Gesetze dem Staat Zugriff auf Firmendaten erlauben, besteht das Risiko, dass diese Informationen irgendwann bei der chinesischen Regierung landen.
Jedes Gerät kann aus der Ferne ausgelesen werden
Wenn man einmal ins Visier gerät – sei es aus politischen, wirtschaftlichen oder kriminellen Gründen –, gibt es kaum noch Schutz. Es gibt Spyware, mit der man Smartphones, Laptops, Tablets oder sogar Smart-TVs aus der Ferne komplett auslesen kann, ohne dass man in der Nähe sein muss. Solche Angriffe laufen oft ohne Klick. Spyware wie Pegasus vom israelischen Unternehmen NSO Group oder Predator von Intellexa ermöglicht (Zero-Click-Exploits): Eine unsichtbare Nachricht reicht, und schon hat der Angreifer vollen Zugriff auf Kamera, Mikrofon, Nachrichten, Fotos und Dateien. Manche dieser Tools kosten für ein einzelnes Zielgerät zwischen einigen Tausend und mehreren Zehntausend Dollar – je nach Qualität und Anbieter. Es gibt kommerzielle Anbieter, die solche Dienste verkaufen, und auf dem Schwarzmarkt werden ähnliche Möglichkeiten angeboten. Man braucht oft nur eine Telefonnummer oder einen engen Kontakt, der die App des Ziels hat. Kosten? Für Pegasus starten sie bei 500.000 Dollar Setup plus pro Zielgerät, aber es gibt Berichte über günstigere Optionen auf dem Schwarzmarkt oft im fünf- bis sechsstelligen Bereich, was für einfachere Tools plausibel ist.
Die US-Regulierungsbehörde FTC hat kürzlich Datenbroker wie X-Mode oder InMarket bestraft, weil sie sensible Standortdaten verkauft haben.
Apps teilen Daten schon durch Nähe
Wenn zwei Handys nah beieinander sind, tauschen sie über bestimmte Apps automatisch Daten aus – auch ohne dass man das merkt. Besonders Apps von Meta (Facebook, Instagram) nutzen Standortdienste, Bluetooth, WLAN und andere Signale, um zu erkennen, wer sich in der Nähe aufhält. Das nennt man Geo-Fencing oder Proximity-Sharing. Dadurch kann man manchmal sogar ohne Telefonnummer herausfinden, wer gerade bei wem ist, und so Daten verknüpfen.
Und... Die KI war für die Öffentlichkeit neu – für Geheimdienste nicht
Während die meisten Menschen erst seit 2023/2024 richtig mit generativer KI in Berührung kommen, setzen Geheimdienste wie die CIA schon seit vielen Jahren KI ein – damals noch nicht für schicke Videos oder Deepfakes, sondern für die Analyse riesiger Datenmengen, Mustererkennung und Vorhersagen. Dieser Vorsprung von 15 Jahren oder mehr bedeutet, dass die tatsächlichen Fähigkeiten von Ländern wie China oder den USA wahrscheinlich weit über dem liegen, was öffentlich bekannt ist.
Bereits 1999 gründete die CIA ihren eigenen Technologie-Investmentarm In-Q-Tel, Ziel war es, neue Technologien aus dem zivilen Markt schnell für nachrichtendienstliche Zwecke nutzbar zu machen. Schon bis 2006 hatte In-Q-Tel über 90 Unternehmen finanziert und mehr als 130 Technologien in die US-Geheimdienstgemeinschaft eingebracht.
Ein sehr bekanntes Beispiel ist Palantir. Es Unternehmen wurde ab 2004/2005 durch In-Q-Tel mitfinanziert. Palantir entwickelte Software, mit der riesige Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen verknüpft, analysiert und nach Mustern durchsucht werden konnten – also genau jene Fähigkeiten, die heute unter „KI-gestützter Analyse“ zusammengefasst werden.
Zwischen 2005 und 2008 war die CIA einer der zentralen frühen Anwender dieser Plattform. Die Software wurde genutzt, um Zusammenhänge in komplexen Datensätzen sichtbar zu machen, Netzwerke zu analysieren und Hinweise auf sicherheitsrelevante Aktivitäten schneller zu erkennen. Dass die KI und maschinelles Lernen inzwischen einen festen Bestandteil der Strategie bilden, zeigt auch der wachsende KI-Schwerpunkt im aktuellen In-Q-Tel-Portfolio. Die Entwicklung verlief also nicht abrupt, sondern über mehr als zwei Jahrzehnte.
Der verbreitete Eindruck, staatliche KI-Nutzung habe erst mit modernen Sprachmodellen begonnen stimmt also nicht. Datenanalyse, Mustererkennung und algorithmische Auswertung gehören im US-Geheimdienstapparat spätestens seit Mitte der 2000er Jahre zum operativen Geschäft.
Wie schützt man sich überhaupt noch?
Desillusionierende Antwort … schwer… In der heutigen Welt ist fast nichts mehr wirklich privat, sobald man gezielt ins Visier gerät. Trotzdem kann man einiges tun: unnötige Apps löschen, Berechtigungen stark einschränken, Standortdienste nur bei Bedarf einschalten, VPN nutzen und regelmäßig Geräte prüfen. Behörden wie die FTC in den USA greifen inzwischen gegen Datenhändler durch, die sensible Infos verkaufen. Aber der beste Schutz bleibt: möglichst wenig digitale Spuren hinterlassen. JE
Quellen...
1. https://iapp.org/news/a/21-5-million-breached-in-second-opm-hack/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/2015_Office_of_Personnel_Management_data_breach
3. https://www.cfr.org/event/tiktok-clock-data-deals-and-national-security
4. https://www.forbes.com/sites/richardnieva/2022/08/18/tiktok-in-app-browser-research/
5. https://www.abc.net.au/news/2022-08-22/tiktok-in-app-browser-can-monitor-keystrokes-researcher-finds/101356198
6. https://krausefx.com/blog/page3/
7. https://proton.me/blog/tiktok-keylogging
8. https://privacycenter.instagram.com/dialog/what-info-is-shared-when-using-location-services/
9. https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/01/ftc-order-prohibits-data-broker-x-mode-social-outlogic-selling-sensitive-location-data
10. https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/01/ftc-order-will-ban-inmarket-selling-precise-consumer-location-data
11. https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/ftc-settles-with-data-brokers-that-sold-political-pregnancy-info-2024-12-03/
12. https://citizenlab.ca/research/forcedentry-nso-group-imessage-zero-click-exploit-captured-in-the-wild/
13. https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/08/DOC1044872021ENGLISH.pdf
14. https://www.wired.com/story/pegasus-spyware-war-zone-first-time/
15. https://cdn.amnesty.at/media/11606/amnesty-report_caught-in-the-net_the-global-threat-from-eu-regulated-spyware_oktober-2023.pdf
16. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/markets-matter-a-glance-into-the-spyware-industry/
17. https://www.recordedfuture.com/research/intellexas-global-corporate-web
18. https://apnews.com/article/7d2de01d3ac5ab2b8ec2239dc7f2b20d
19. https://www.stealthgpt.ai/blog/how-the-cia-uses-ai
20. https://theconversation.com/intelligence-agencies-have-used-ai-since-the-cold-war-but-now-face-new-security-challenges-204320
21. https://medium.com/@len213noe/these-social-media-apps-secretly-track-your-location-92b9c4cd5288
22. https://academic.oup.com/jogss/article/8/2/ogad005/7128314
23. https://en.wikipedia.org/wiki/In-Q-Tel
24. https://www.britannica.com/money/Palantir-Technologies-Inc
25. https://www.theaiopportunities.com/p/the-palantir-origin-playbook-20032013
26. https://en.wikipedia.org/wiki/Palantir
27. https://sherwood.news/business/ai-companies-cia-is-investing-in/
25.02.2026
18:11 | rega-net: Der Autoritäre Block
Die Auslagerung von Kernaufgaben des Militärs und anderer sicherheitsrelevanter staatlicher Aufgaben an Privatunternehmen ist das Thema einer umfassenden Recherche, die Francesca Bria, José Bautista und xof-research.org unter dem Titel "The authoritarian stack", auf Deutsch "der autoritäre Block", veröffentlicht haben.
Mit vielen Namen, Grafiken und aufklappbaren Übersichtstabellen hier anzusehen, oder als Text „United States of Palantir“ von Francesca Bria auch in Le Monde Diplomatique zu lesen. Als ein besonders deutliches Beispiel beschreibt Bria da einen zehn Milliarden Dollar schweren Vertrag, den die Führung der US-Streitkräfte im Juli 2025 mit dem Unternehmen Palantir Technologies unterzeichnete und dadurch "heimlich, still und leise ein entscheidendes Stück ihrer Eigenständigkeit“ abgegeben habe.
Ende Juli 2025 trat das US-Militär tief im bürokratischen Apparat des Pentagons still und leise einen Teil seiner Souveränität ab. Ein Zehn-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Palantir Technologies — einer der größten in der Geschichte des Verteidigungsministeriums — wurde als Schritt in Richtung „Effizienz" dargestellt. Er fasste fünfundsiebzig Beschaffungsvereinbarungen in einem einzigen Vertrag zusammen.
Kommentar des Einsenders
Detaillierte Strukturen des aufkommenden Transhumanistischen-Digitalen Techno-Faschismus.
Beide links gehören zusammen. Must read.
Das ist kein Putsch mit Panzern. Das ist ein Update im Hintergrund und keiner hat die Lizenzbedingungen gelesen. JE
12:04 | Mises: Zentralbankschließung und Hyperinflation
Wie kommt man aus dem Fiatgeld wieder heraus? Zentralbank zusperren und Schlüssel wegwerfen oder Schritt für Schritt?
Zwei ausgewiesene Experten und Austrians diskutieren ihre unterschiedlichen Standpunkte.
.. rufen Sie Bachheimer an! Die Lösung mit Bachi ... da lach i. TS
24.02.2026
10:41 | WP: Operation Trust: Die hundert Jahre alte sowjetische Psyop, neu verpackt als QAnon und die MAGA-Bewegung
„Die beste Propaganda ist die, die sozusagen unsichtbar wirkt und das gesamte Leben durchdringt, ohne dass die Öffentlichkeit etwas von der propagandistischen Initiative weiß.“ – Joseph Goebbels, Propaganda-Genie des nationalsozialistischen Deutschlands
Die Vereinigten Staaten zerfallen. Sie kollabieren. Sie steuern auf den Abgrund zu. Die Titanic sinkt, und nichts kann sie daran hindern, auf dem Grund des Atlantiks zu ruhen. Doch viele Amerikaner glauben immer noch, alles sei großartig, wir seien wohlhabender denn je, lebten inmitten einer großen spirituellen Erweckung, und es gäbe nur gute Zeiten und positive Schwingungen.
Während die Make America Great Again (MAGA)- und QAnon-Bewegungen zweifellos an Bedeutung verlieren und einen Großteil ihrer Anhängerschaft einbüßen, genießt Präsident Donald Trump immer noch großen Beifall in der amerikanischen Bevölkerung. Diese Menschen stimmen scheinbar allem, was er sagt und tut, ohne große Fragen zu stellen, selbst wenn die jüngste Wendung in der Erzählung regelmäßig früheren Aussagen und Versprechen widerspricht; was auch immer Trump in dem Moment sagt oder postet, wird von den meisten als heilig, als unumstößliche Wahrheit angesehen.
„Make America Great Again.“
„Den Sumpf trockenlegen.“
„Goldenes Zeitalter.“
„Amerika zuerst.“
„Den Tiefen Staat beenden.“
„4D-Schach.“
„Missbrauch, Betrug und Verschwendung beseitigen.“
„Großes Erwachen.“
„Stellt die Republik wieder her.“
„Der Sturm.“
„Rote Pille.“
„Besiegt die Globalisten.“
„Fallt die Kabale.“
„Hoffnung“
„Gewinnen.“
„Wo einer hingeht, gehen alle hin“ (WWG1WGA).
„White Hats“
„Vertraue dem Plan.“
.. und dann kam Epstein .. sonst wäre es ja so schön gewesen, wenn ab und an ein kleines Bröserl vom Tisch gefallen wäre. Oder? TS
21.02.2026
15:28 | Rüdiger Rauls: Amerikas neue Weltordnung
Auf der Sicherheitskonferenz 2025 hatte US-Vizepräsident J.D. Vance den Europäern noch die Leviten gelesen. In diesem Jahr kam Außenminister Rubio mit dem Angebot einer neuen Ordnung. Auf welchem Weltbild beruht sie und wie realistisch sind dessen Grundlagen ?
Neue Besen
Als J.D.Vance im vergangenen Jahr die Bühne bei der Münchener Sicherheitskonferenz betrat, war er noch der neue Besen, der gut kehrt. Die MAGA-Bewegung in den USA strotzte vor Kraft nach dem Wahlsieg ihres Präsidenten Donald Trump. Vance las den Europäern ordentlich die Leviten. Das betraf besonders jenen Bereich, in dem sie sich immer wieder gerne als die Weltmeister darstellten: die Werteorientierung. Hierin fühlten sie sich allen anderen Nationen moralisch überlegen und glaubten deshalb auch, überall als Zuchtmeister und Oberlehrer auftreten zu können. Dass ihnen gerade in diesem Bereich Vance die Kompetenz absprach, hatte sie schwer getroffen.
Wenn sich auch einige von Amerikas Wunschträumen inzwischen der Wirklichkeit hatten beugen müssen, war der damalige Auftritt von Vance der erste Wermutstropfen, den der große Bruder auf der anderen Seite des Atlantiks den Verbündeten verabreichte. Es blieb nicht der einzige. Die USA scherten aus der Unterstützung der Ukraine. Zudem bootete Trump die Europäer aus, indem er sich über ihre Köpfe hinweg mit Putin ins Benehmen setzte über die Beendigung des Krieges und die Aufteilung der ukrainischen Beute.
Die Amerikaner gaben zu verstehen, dass sie keine Einwände haben gegen die Abtretung der Ostukraine an Russland, schließlich hatten sie sich doch bereits die Schürfrechte für die Restukraine gesichert. Und die Russen hatten schon deutlich gemacht, dass der Friede in der Ukraine Amerikas Schaden nicht sein wird. Nun muss nur noch der Frieden kommen, damit amerikanische Unternehmen diesen Schatz endlich heben können. Darüber hinaus locken auch in Russland gute Geschäfte für Trump und die amerikanische Wirtschaft.
Außerdem hatten die neuen Besen in Washington damit begonnen, den Europäern die Waffen für die Ukraine in Rechnung zu stellen. Die Amerikaner waren nicht mehr bereit, sie auf eigenes Risiko an Kiew zu liefern. Nach dem Frieden dürften die Europäer vermutlich bei der Aufteilung der Beute in die Röhre schauen und auf den Schulden für die Unterstützung der Ukraine sitzen bleiben. Denn wahrscheinlich wird Kiew diese niemals bedienen können. Damit aber nicht genug der amerikanischen Zumutungen. Als nächstes kamen neue Zölle, mit denen Trump den Europäern klar machte, welche Rolle er ihnen in den neuen Beziehungen zuwies. Europa war nichts weiter mehr als die Melkkühe für die Gesundung der amerikanischen Wirtschaft. Zölle auf europäische Produkte sollten die amerikanischen Staatseinnahmen heben und die Defizite senken. Sie sollten darüber hinaus auch europäische Unternehmen in die USA locken, um auf diesem Wege die Zölle zu umgehen.
Aber all diese Kröten wäre man von europäischer Seite bereit gewesen zu schlucken, hätte Trump nicht den ergebensten Verbündeten militärisch gedroht. Er verlangte Grönland für die USA und hatte den Einsatz von Waffengewalt zur Erlangung dieses Ziels nicht ausgeschlossen. Inzwischen ist er zwar zurück gerudert, aber die Europäer trauen den USA nicht mehr. Das Verhältnis ist zerrüttet. Es wird immer deutlicher, dass der alte Bundesgenosse USA mit eisernem Besen durch die alte Weltordnung fegt und auch vor altgedienten Freunden nicht Halt macht. In dieser Hinsicht sorgte US-Außenminister Rubio in München für Klarheit: Die alte Ordnung gibt es nicht mehr.
Altes Denken
Aber auch diese alte Ordnung, die sogenannte regelbasierte, war eine amerikanische. Die USA haben also kurzerhand nur das Hemd gewechselt. Was das Neue in dieser neuen Ordnung sein und was sie bringen soll, hatte Marco Rubio in München unmissverständlich zum Ausdruck gebracht: „Wir dürfen die globale Ordnung nicht länger über die nationalen Interessen unserer Länder stellen“(1). Rubio wie auch Trump und die gesamte MAGA-Bewegung sehen nicht oder wollen nicht wahrhaben, dass auch die bisherige Ordnung eine amerikanische war und in erster Linie amerikanischen Interessen gedient hatte. Aber die „dogmatische Ideologie des freien und unregulierten Handels“(2) hat ausgedient.
Diese Ideologie, bekannt als Globalisierung, war von den Amerikanern angestoßen worden durch die Öffnung des Westens gegenüber China. Die Volksrepublik hauchte den alten Industrien, besonders der Textil- und eisenverarbeitenden Industrie, die im politischen Westen keine ordentliche Rendite mehr abwarfen, neues Leben ein. Ganze Industriebereiche verlagerten ihre Produktion nach China, ohne dass sie dazu gezwungen worden wären. An dessen Werkbänken trafen sie auf billige, hoch motivierte und gut ausgebildete Arbeitskräfte. China wurde zur Frischzellenkur für den westlichen Kapitalismus.
Aber von Globalisierung spricht heute keiner mehr in den USA. Stattdessen haben westliche Theoretiker die regelbasierte Ordnung ausgerufen. Schon dieses Schlagwort war ein Eingeständnis der veränderten wirtschaftlichen Bedingungen. China war nicht länger die Werkbank der Welt. Die Volksrepublik hatte für sich die Welt als Markt entdeckt und sich weitgehend unabhängig gemacht von den ehemaligen Kapitalgebern aus dem politischen Westen. Sie war aufgestiegen von der Werkbank der Welt zum Konkurrenten auf dem Weltmarkt. Dem versuchte man, Einhalt zu gebieten, indem der politische Westen neue Regeln schuf, die sogenannte regelbasierte Ordnung.(3)
Er schuf diese eigenmächtig, verordnete sie aber für den Rest der Welt. Doch auch sie erwiesen sich als ungeeignet, den Höhenflug Chinas aufzuhalten. Als die großen Verlierer dieser Entwicklung sehen die USA sich gezwungen, die bisher gültige globale Ordnung wieder den „nationalen Interessen unserer Länder“ unterzuordnen. Aber gerade Europa ist der beste Beweis für die Irrationalität dieses Denkens, das die MAGA-Bewegung als verheißungsvolle Offenbarung und weitblickende Weisheit betreibt. Gerade die Betonung der nationalen Interessen hatte im 20. Jahrhundert nicht nur dem Kontinent selbst, sondern auch dem Rest der Welt unermessliches Leid gebracht.
Rubio will den gesamten politischen Westen für die neue Vision der MAGA-Bewegung gewinnen. Vielleicht steckt dahinter die Ahnung, dass die USA es alleine nicht werden aufnehmen können mit China und Russland und all den anderen Staaten, die der Bevormundung durch den politischen Westen überdrüssig sind. Von jenen sehen sich Rubio und seine Gesinnungsgenossen bedroht. Wie bereits die neue Sicherheitsstrategie zeigte, befürchtet man die eigene „zivilisatorische Auslöschung“, durch die Migrationsbewegungen in der Welt. Ihm geht es darum, die „westliche Zivilisation zu schützen, zu stärken und die westliche Vorherrschaft zu sichern“(4).
Um die Europäer dafür zu gewinnen, appelliert er an Gemeinsamkeiten: die „große europäische Kultur, die gemeinsame Geschichte, die gemeinsame westliche Zivilisation“(5) und vor allem der christliche Glaube. Besonders letzterer ist für ihn das Verbindende zwischen Amerika und Europa, die gemeinsame Wurzel. Doch beide verbinden auch die Niederlagen der vergangenen Jahre: Das Ende der Kolonialherrschaft durch die Befreiungskriege und die Herrschaft des Kommunismus. Gegen den Niedergang will er neue Hoffnung verbreiten, dass der „Westen nach 500 Jahren expansiver Geschichte nun ein weiteres Kapitel seiner Dominanz schreiben müsse“ (6).
Neue Widersprüche
Rubio spricht von „unseren Ländern“ und meint damit die des politischen Westens. Die globale Mehrheit wird aus diesem Weltbild ausgeschlossen. Auch andere Religionen außer dem Christentum bedeuten ihm wenig. Die MAGA-Bewegung ist weiß und christlich, sieht sich in der Tradition der europäischen Kultur, entstammt denselben Wurzeln, erinnert an Herrenmenschendenken. Damit scheint Rubio bei den Europäern Anklang finden zu wollen. Gleichzeitig macht er aber auch deutlich: „Wir sind bereit, wenn nötig, dies allein zu tun. Auch wenn man es lieber zusammen mit den Freunden in Europa täte.“(7).
Das heißt, die Europäer können sich anschließen, aber untergeordnet unter den Vorstellungen der USA. Nach diesen Worten lässt er Taten folgen. Er hielt er sich nach der Konferenz nicht lange mit den alten Verbündeten in München auf, sondern stattete den neuen Freunden in Ungarn und der Slowakei einen Besuch ab. Er, Trump und die gesamte MAGA-Bewegung warten nicht auf die Entscheidung der alten Gefolgsleute, denn man hat in Europa schon neue gefunden, die den MAGA-Gedanken von der Betonung der eigenen Interessen voll unterstützen.
Ob die Politikvorstellungen der USA und der Slowakei wirkliche so weit übereinstimmen, wenn Rubio erklärt „seine Regierung erwarte von jedem Land der Welt, im eigenen Interesse zu handeln“(8), oder geht es dabei nicht doch eher um Wortmeldungen für die abendlichen Nachrichtensendungen? Angesichts der Wahlen in Ungarn versicherte er Victor Orban, dass „Präsident Trump sich zutiefst für Ihren Erfolg einsetzt, denn Ihr Erfolg ist unser Erfolg“(9). Doch gilt das alles noch, wenn die Interessen nicht übereinstimmen? Ein Konfliktpunkt zwischen den USA auf der einen und den neuen Freunden in Ungarn und der Slowakei besteht bereits in der Lieferung russischen Öls. Es scheint im amerikanischen Interesse zu liegen, Russland vom europäischen Energiemarkt zu verdrängen. Dementsprechend verlangt man auch von den Freunden in Ungarn und der Slowakei, „sich von russischen Energielieferungen zu lösen“(10). Da geraten die amerikanischen nationalen Interessen mit denen nationalen Interessen Ungarns und der Slowakei in Konflikt. Beides geht wahrscheinlich nicht.
Und noch widersprüchlicher wird die wohl gemeinte Erklärung Rubios, den nationalen Interessen Vorrang zu gewähren, wenn sie auch von China, dem Iran, Russland, Kuba und so vielen anderen sanktionierten Staaten in Anspruch genommen wird. Denn auch der Iran hat ein nationales Interesse an seiner Urananreicherung und dem Erhalt seiner Raketenbestände. Denn was der Atommacht und die Raketengroßmacht USA recht ist, dürfte nach der scheinbar wohlwollenden Erklärung Rubios in Bratislava dem Iran und Nord-Korea billig sein: Der Besitz von Raketen und Atomwaffen zu ihrem eigenen Schutz, so wie sie ihn verstehen.
Die USA und die Theoriedisigner der MAGA-Bewegung begeben sich mit ihrer neuen Ordnungsvorstellung in erheblich Erklärungsnöte und politische Schwierigkeiten. Zwar können sie sich selbst mit ihrem Vorrang der nationalen Interessen aller Beschränkungen in der Anwendung von Gewalt entledigen. Aber das gilt auch für alle anderen Staaten der Welt. Entweder können die MAGA-Theoretiker nicht so weit denken oder aber sie verstehen die nationalen Interessen anderer Staaten nur im Geleitzug mit dem amerikanischen nationalen Interesse. Wenn auch viele Staatslenker in den Erklärungen von Trump und Rubio Vorteile für sich zu sehen glauben, so zeichnet sich aus dem Verhalten der USA doch eher ab, dass die Betonung des nationalen Interesses alleine als ein amerikanisches Vorrecht angesehen wird. Anderen Nationen dürfte das nur so lange eingeräumt werden, wie es den US-Interessen dient oder zumindest nicht im Wege steht. Das hat man mit der Idee von der Globalisierung schon versucht wie auch mit der regelbasierten Ordnung. Die Entwicklung aufhalten aber konnten diese wohlklingenden Theorien nicht. Immer deutlicher zeigt sich, dass die Welt der amerikanischen Vorherrschaft wie auch der des gesamten politischen Westens überdrüssig ist.
(1, 2) Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 16.2.2026 Wenn der Staub sich legt
(3) Siehe dazu Rüdiger Rauls: Chinas Wirtschaft – auf zur Weltspitze!
(4, 6, 7) FAZ 16.2.2026 Wenn der Staub sich legt
(8) FAZ 16.2.2026 Rubios neue NATO
(9, 10) FAZ 17.2.2026 Schützenhilfe in der ungarischen Schlammschlacht
Rüdiger Rauls ist Reprofotograf und Buchautor. Er betreibt den Blog Politische Analyse
19.02.2026
14:29 | konjunktion: Systemfrage: Wenn alle Staaten weltweit das Gleiche tun, dann ist es eine globale Falle
Die Nationen müssen sich zu einer Weltregierung zusammenschließen oder untergehen. – Charles de Gaulle
Die Eine-Welt-Regierung und die Neue Weltordnung (aka Großer Neustart) ist kein neues Konzept, aber eines, das in diesem Jahrhundert seinen Höhepunkt erreicht hat. Der entscheidende Moment dieser bösartigen geheimen Partnerschaft der Nationen wurde während der Plandemie, die 2020 von den Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) eingeläutet wurde, für alle sichtbar. Es war weder das erste noch das letzte Mal, aber der Vorhang wurde gelüftet und die Regierungen wurden vollständig als Erfüllungsgehilfen der IGE entlarvt; eine offene Vorschau auf die eine Welttechnokratie, die als neue multitechnologische Ordnung strukturiert wird. Derzeit ist das zentrale Kontrolltechnat für diese Weltherrschaft das Technat von Amerika oder das nordamerikanische Technat. Die Pläne für diesen Staatsstreich wurden vor fast 100 Jahren geschmiedet und werden nun zur Realität.
Kommentar des Einsenders
Point of no return is over.
Plandemie als globaler Dressurakt – einmal testen, wie schnell sich 8 Milliarden auf Kommando einsperren lassen, während Politik den Blinker „Demokratie“ setzt, aber längst im Autopilot der Technokraten fährt. Nationalstaat? Kulisse. Entscheidungsmacht? In Gremien ohne Wahlzettel. JE
18.02.2026
19:09 | Wir besitzen längst nichts mehr – wir haben es nur noch nicht bemerkt.
Es ist kein Trend. Es ist auch kein „nachhaltiges Umdenken“. Es ist ein Geschäftsmodell. Und wie so oft wird es uns als super praktisch verkauft.
Es ist die neue Welt des Mietens...
2024 testet IKEA Möbel zum Mieten. H&M eröffnet „Take Care“-Reparaturservices. Klingt ökologisch. Klingt verantwortungsvoll. Klingt nach einem System, das plötzlich sein nachhaltiges Gewissen entdeckt hat.
Aber stellen wir die nüchterne Frage: Seit wann verzichten Konzerne freiwillig auf die Marge?
Es ist kein Umweltprojekt. Es ist die nächste Evolutionsstufe des Kapitalmarkts: planbare, wiederkehrende Einnahmen. Abonnements. Zugriff statt Besitz.
Die Universität Osnabrück spricht von der „Subscription Economy“ – ein Markt, der bis 2034 auf rund 1,5 Billionen Dollar anwachsen soll.
Das Entscheidende dabei ist nicht Nachhaltigkeit. Das Entscheidende ist Kontrolle.
BMW: Hardware gehört dir – Nutzung nicht...
BMW begann 2022 damit, Sitzheizungen und andere bereits verbaute Funktionen per Software-Abo freizuschalten.
17 Euro im Monat – für Hardware, die Sie bereits bezahlt haben.
Man verkaufe künftig „Zugang“ statt nur Autos.
Rechnet man das durch, kommt man bei 20 Jahren Nutzung auf über 4.000 Euro für eine Sitzheizung.
Das ist ein Magageschäft.
Wiederkehrende Umsätze sind an der Börse wertvoller als einmalige Verkäufe. Das honorieren Analysten – und Großinvestoren. Später folgte der Rückzieher.
Tesla: Softwareplattform die nebenbei auch Autos produziert...
Tesla verlangt für sein Full Self Driving Paket bis zu 8.000 Dollar oder 99 Dollar monatlich. 2024 generierte FSD rund 1,8 Milliarden Dollar Umsatz. Gleichzeitig berichten Medien über Fehlbremsungen und Probleme bei der Objekterkennung.
Und nicht zu vergessen die Kill-Switch-Funktion. Bei der ist es sofort vorbei mit der Selbstbestimmung über sein Eigentum....
Aus Sicht der Kapitalmärkte zählt etwas anderes: Software-Abos erhöhen die Bewertung des Unternehmens. Tesla ist nicht primär Autohersteller. Tesla ist eine Plattform mit Rädern.
Samsung & Co: Du bezahlst – und wirst zum Produkt
Moderne Smart-TVs erfassen über sogenannte ACR-Technologie (Automatic Content Recognition), was auf dem Bildschirm läuft. Untersuchungen zeigen, dass Geräte bereits bei der Einrichtung Daten an Google oder Microsoft übertragen.
Branchenberichte beschreiben, dass TV-Hersteller diese Datenerfassung aktiv monetarisieren – etwa über eigene Werbeplattformen wie „Samsung Ads“. Sie zahlen 1.200 Euro für den Fernseher – und liefern zusätzlich verwertbare Daten.
Der klassische Produktverkauf wird ergänzt durch ein datengetriebenes Erlösmodell.
HP: Der Drucker als Abofalle
Mit „HP Instant Ink“ etablierte HP ein Abo-Modell für Druckertinte. Berichte kritisieren, dass nach bestimmten Firmware-Updates Fremdpatronen blockiert wurden. Der Kunde kauft einen Drucker – aber doch er bleibt im HP Ökosystem gefangen.
Adobe: Vom Eigentum zur Dauergebühr
Adobe stellte sein Geschäftsmodell von Einmalkäufen auf die Creative Cloud um. Statt einmalig rund 1.000 Euro zahlt der Nutzer nun dauerhaft monatliche Gebühren – aktuell rund 60 Euro und mehr. 2025 wurden zusätzliche KI-Funktionen nur über „Generative Credits“ zugänglich gemacht – gegen Aufpreis. natürlich... Das Prinzip ist klar. Wir mieten Software. Die Software wird künstlich segmentiert. Und mehr Leistung bedeutet mehr Gebühr.
Gaming: Du besitzt gar nichts mehr...
Digitale Spieleplattformen wie Steam verkaufen keine Eigentumsrechte, sondern Lizenzen. Diese können gemäß AGB entzogen werden. Nach regulatorischen Änderungen wurden bestimmte Spiele in Deutschland gesperrt.
Das zeigt: Digitale Güter sind nicht Unser Eigentum. Sie sind Nutzungsrechte unter Vorbehalt.
BlackRock & das System dahinter
BlackRock verwaltet rund 11,58 Billionen Dollar Vermögen. Studien zeigen, dass BlackRock gemeinsam mit Vanguard und State Street zu den größten Anteilseignern zahlreicher DAX- und US-Unternehmen gehört. Mit dem Risikomanagement-System „Aladdin“ analysiert BlackRock Billionen an Kapitalströmen weltweit. BlackRock muss keine operative Kontrolle ausüben. Es reicht, Geschäftsmodelle zu bevorzugen, die planbare Cashflows liefern.
Amazon Prime: Der absolute König der Dark Patterns
2025 zahlt Amazon 2,5 Milliarden Dollar Strafe und Rückerstattungen an die FTC – weil Prime mit Dark Patterns Millionen Nutzer unabsichtlich in Abos gelockt und Kündigungen absichtlich zur Qual gemacht hat. Ist kein Einzelfall... Es ist die Regel in einer Subscription Economy, wo der einfachste Weg reinführt – und der schwierigste raus.
Amazon nutzte irreführende Interfaces – riesige „Free Shipping“-Buttons, winzige „No thanks“-Links, versteckte Auto-Renewal-Hinweise. Millionen wurden ohne echtes Wissen eingeschrieben. Kündigen? Ein Labyrinth aus Pop-ups, Retention-Angeboten und versteckten Schritten – intern „Iliad Flow“ genannt, nach dem endlosen Trojanischen Krieg
Das Ergebnis: Historische 1 Milliarde Dollar Strafe + 1,5 Milliarden Rückerstattungen. Aber der Schaden ist da: Viele zahlten jahrelang für etwas, das sie gar nicht wollten.
John Deere: Dein Traktor gehört dir – die Reparatur nicht
Landmaschinen mit Software-Sperren: Voll funktionsfähige Diagnose-Tools nur für Dealer oder gegen jährliche Lizenz (ab 195 $ pro Maschine). FTC verklagte 2025: Monopolisierung von Reparaturen, höhere Kosten für Farmer, unabhängige Werkstätten ausgeschlossen. Du kaufst den Traktor – aber ohne Abo oder teure Lizenzen kannst du ihn nicht richtig reparieren.
Und nichts liefert stabilere Cashflows als Abonnements.
Das Muster...
1. Produkt verkaufen
2. Funktion per Software kontrollieren
3. Zugriff segmentieren
4. Monatliche Zahlung etablieren
5. Bewertung am Kapitalmarkt steigern
6. Alles nach Goodwill des Unternehmens, der Zugriff kann jederzeit verweigert werden.
Wiederkehrende Umsätze erhöhen die Unternehmensbewertung. Höhere Bewertungen erhöhen die Gewichtung in ETFs. Höhere ETF-Nachfrage stabilisiert den Kurs. Ein sich selbst verstärkender Kreislauf.
Und jetzt?
Solange Verbraucher das Modell akzeptieren, wird es sich ausbreiten. Wenn Nachfrage kippt, kippen Strategien. Und die Geschichte zeigt: Systeme sind nie alternativlos. Aber sie verändern sich nur, wenn genügend Menschen die Mechanik dahinter erkennen.
Das ist Enteignung mit Monatsrate.
Früher hast du gekauft.
Heute darfst du benutzen – solange du zahlst und still bist.
„Flexibel“ heißt kündbar.
„Kündbar“ heißt abschaltbar.
„Abschaltbar“ heißt: nie wirklich deins.
Das System ist nicht kaputt.
Es funktioniert großartig.
Und... wir sind die, die brav zahlen – und es noch Innovation nennen. JE
Links
1. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/subscription-economy-market-report
2. https://www.mpi-fg-koeln.mpg.de
3. https://www.inside-digital.de/news/bmw-gesteht-ein-das-war-ein-grosser-fehler
4. https://www.inside-digital.de/news/rueckzieher-von-bmw-doch-keine-abomodelle-fuer-sitzheizung-und-co-bmw
5. https://cleantechnica.com/2024/04/15/tesla-full-self-driving-supervised-now-99-month-reflections-on-4-5-years-with-tesla-fsd
6. https://www.tesla.com/support/full-self-driving-subscriptions
7. https://assets-ir.tesla.com/tesla-contents/IR/TSLA-Q4-2025-Update.pdf
8. https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/67106642-vor-fsd-demo-in-deutschland-teslas-autopilot-system-scheitert-an-laub-erkennung-397.htm
9. https://www.consumerreports.org/electronics/privacy/how-to-turn-off-smart-tv-snooping-features-a4840102036
10. https://www.zdnet.com/home-and-office/home-entertainment/how-to-disable-acr-tv
11. https://www.samsung.com/de/business/samsungads/
12. https://www.farbtoner.shop/en/Firmware-updates-A-threat-to-compatible-cartridges:_:145.html
13. https://www.adobe.com/de/creativecloud/plans.html
14. https://helpx.adobe.com/account/individual/subscriptions-and-plans/plan-types-and-eligibility/changes-to-individual-plan.html
15. https://helpx.adobe.com/creative-cloud/apps/generative-ai/generative-credits-faq.html
16. https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/
17. https://www.gamestar.de/artikel/deutsche-steam-sperre-jugendschutz,3423119.html
18. https://www.investmentnews.com/alternatives/blackrock-hits-1158t-asset-record-as-profit-declines/260087
19. https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations
20. https://en.wikipedia.org/wiki/Aladdin_(BlackRock)
21. https://www.blackrock.com/aladdin
22. https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/09/ftc-secures-historic-25-billion-settlement-against-amazon
23. https://www.ftc.gov/enforcement/refunds/amazon-refunds
24. https://mashable.com/article/amazon-prime-ftc-settlement-refund-details
25. https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/2123050-amazoncom-inc-rosca-ftc-v
26. https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/09/ftc-secures-historic-25-billion-settlement-against-amazon
27. https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/01/ftc-states-sue-deere-company-protect-farmers-unfair-corporate-tactics-high-repair-costs
28. https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/01/ftc-states-sue-deere-company-protect-farmers-unfair-corporate-tactics-high-repair-costs
29 https://www.farm-equipment.com/articles/20002-ongoing-coverage-right-to-repair-impact-on-dealers-deere-other-oems
17.02.2026
Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass algorithmische Kriegsführung die Zukunft ist und damit eine enorme Anzahl von Zero-Day-Cyberangriffen einhergehen wird, so der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC).
„Wenn man Code schreiben kann, kann man auch Cyberangriffe schreiben. Eine der Folgen davon wird sein, dass es zu einer enormen Anzahl von Zero-Day-Cyberangriffen kommen wird.“
Eric Schmidt, Münchner Sicherheitskonferenz, Februar 2026
Leser Kommentar
Die transhumanistische Kreatur hofft das KI eine Religion wird und ist auf dem besten Wege dahin.
Der kommende Konflikt wird in der ersten Phase mit KI und Algorithmen geführt werden und ein passendes Beispiel dafür .. war der Einsatz der Javlin im ersten Teil des Ukraine Kriegs. Infrarot und Bildgebung als Zielsuchkopf .. und setze Russland "alte Tanks" ein.
Wie hat man im Westen gelacht ... als man die T55 wieder am Gefechtsfeld gesehen hat. ... und hört man heute noch was von der Javlin?
Die zweite Phase des KI Krieges wird ... altmodisch sein. Messer, Netze, ohne Elektronik. TS
10:59 | Warum folgen so viele wie Schafe der Herde? - Propaganda verstehen von Dr. Jonas Tögel
Immer mehr Menschen fragen sich, warum es so leicht ist, Millionen von Menschen mit einfachen Techniken zu steuern. Ein Grund ist die Tendenz, dass Menschen wie Schafe gerne der Herde folgen. Das ist in der Forschung gut bekannt und wird seit mehr als 100 Jahren mit verschiedenen Propagandatechniken gezielt ausgenutzt.
Wie diese Techniken heute funktionieren und wie wir uns vor Ihnen schützen können, darum geht es in diesem Vortrag meiner Reihe "Propaganda verstehen."
Wer die Deutungshoheit kontrolliert, kontrolliert die Herde – und wer frei bleiben will, braucht mindestens eine zweite Stimme neben sich, die nicht nachplappert, sondern prüft. JE
13.02.2026
15:24 | Rüdiger Rauls: Venezuela: Außer Spesen nichts gewesen.
Um Venezuela ist es ruhig geworden. Bedeutet das, dass dort nun alles zum Besten für Trump steht und er das Land unter Kontrolle hat? Wie sieht es aus um seine Ankündigungen, er werde Venezuela und den USA Wohlstand bringen? Hat sich das Venezuela-Abenteuer ausgezahlt?
Publikumsberuhigung
Aus Venezuela ist bisher wenig Erfolgreiches für die US-Regierung zu vermelden. Zwar finden Verhandlungen statt, und Vereinbarungen über Ölverkäufe wurden getroffen. Im Moment ist darüber hinaus wenig zu erkennen, was Trumps vorlaute Ankündigungen bewahrheitet, Venezuela von Washington aus selbst zu regieren. Im Gegenteil reagierte die amtierende Präsidentin Delcy Rodriguez auf die Einmischungsversuche aus Washington mit der Aufforderung, sich aus den inneren Angelegenheiten des südamerikanischen Landes herauszuhalten: „Es reicht mit den Befehlen aus Washington an Politiker in Venezuela“ (1).
Das wiederum rief wenig später US-Außenminister Marco Rubio auf den Plan, der damit drohte, „Gewalt einzusetzen, um maximale Zusammenarbeit sicherzustellen, wenn andere Methoden scheitern" (2). Seitdem aber hat man von Angriffen vonseiten der US-Regierung nichts mehr gehört. Denn so leicht, wie sich es die MAGA-Theoretiker eingeredet hatten, scheint es nun doch nicht zu sein, von Washington aus einfach mal ein fremdes Land regieren zu können. Inzwischen sieht man sich wohl der bitteren Wahrheit gegenüber, dass man vorerst „keine Alternative zur Zusammenarbeit mit dem bestehenden Machtapparat habe.“ (3).
Vielleicht wollte Trump der Öffentlichkeit mal wieder einen Erfolg seiner Politik präsentieren, als er sich Mitte Januar noch „zufrieden mit der aktuellen Führung Venezuelas gezeigt“ (4) hatte. Aber was bleibt ihm auch anderes übrig, als Schönfärberei zu betreiben und der Öffentlichkeit Sand in die Augen streuen? Man kann zwar von Washington aus Anweisungen erteilen, aber ob diese so umgesetzt werden wie gewünscht, kann schlecht überprüft, geschweige denn durchgesetzt werden, ohne mit Machtmitteln vor Ort zu sein. Da aber die USA in Venezuela selbst nicht über eine starke Machtposition verfügen, könnten das eigentlich nur amerikanische Bodentruppen gewährleisten.
Maria Machado jedenfalls, die von den westlichen Meinungsmachern als die überragende Siegerin der vergangenen Präsidentschaftswahlen herumgereicht worden war, gilt bei den amerikanischen Geheimdiensten „derzeit als nicht regierungsfähig“(5). Ihr fehlen die Verbindungen zum Militär und zum Ölsektor. Jedenfalls scheint man sich in Washington darüber im Klaren zu sein, dass man auf die Kooperation vonseiten der venezolanischen Regierung angewiesen ist, will man nicht gezwungen sein, weitere militärische Schritte gegen Caracas zu unternehmen.
Diese aber dürften in den USA angesichts der ohnehin schon aufgeheizten Stimmung nur zu weiteren Protesten und Schwierigkeiten führen. Vermutlich versucht man deshalb, weitere Konflikte mit der Regierung Rodriguez zu vermeiden, wenn man sich auch in der Öffentlichkeit weiterhin kämpferisch gibt. Bei einer Senatsanhörung am 28. Januar musste Außenminister Rubio zugeben: „Wir sind nicht in der Lage, militärische Maßnahmen in Venezuela zu ergreifen.“ (6) Das sind jedenfalls andere Töne als die vollmundigen Drohungen gegenüber der venezolanischen Präsidentin. Da will man wohl in der amerikanischen Öffentlichkeit die Illusion von Stärke aufrecht erhalten.
Vorteil Venezuela
Aber auch wirtschaftlich droht das Venezuela-Abenteuer nicht zu jenem Erfolg zu werden, den Trump mit prahlerischen Worten in Aussicht gestellt hatte. Das gilt zumindest für die USA. Erinnert sei dabei an die Worte von US-Energieminister Chris Wright, „die Vereinigten Staaten würden nicht nur in Venezuela gelagertes Öl vermarkten, sondern auch den Verkauf der Ölproduktion des Landes auf unbestimmte Zeit kontrollieren.“(7) Auch Trump hatte öffentlich in diese Kerbe gehauen, als er davon phantasierte, dass dank der Vermarktung des Öls durch die USA goldene Zeiten für beide Länder, die USA und Venezuela, anbrechen werden.(8)
Doch bisher hat das Venezuela-Abenteuer dem amerikanischen Steuerzahler nur Kosten verursacht. Abgesehen von den Opfern des amerikanischen Angriffs, drängt sich von außen fast der Eindruck auf, dass Venezuela zumindest wirtschaftlich mehr Vorteile aus der neuen Lage ziehen kann als Nachteile und vielleicht sogar auch mehr als die USA selbst: „Nachdem US-Präsident Donald Trump ... einen Wiederaufbauplan im Umfang von 100 Milliarden Dollar vorgeschlagen hat“ (9), hatte das venezolanische Parlament einer Öffnung des Ölsektors zugestimmt.
Diese stellt nicht nur eine Steigerung der Öl- und Gasproduktion sondern auch der Investitionen in Aussicht, was von interessierten Investoren als gute Grundlage für positive Entscheidungen angesehen wird. Das kommt den Interessen Venezuelas entgegen. Denn von venezolanischer Seite bestand nie ein Interesse daran, Ausbau und Förderung der Erdöl-Produktion zu behindern. Es war weitgehend die Folge der amerikanischen und westlichen Sanktionen, die Caracas daran gehindert hatten, die notwendigen Investitionen vornehmen zu können. Finanzmittel waren blockiert und der Verkauf von Ersatzteilen an die venezolanische Ölindustrie durch Sanktionen beeinträchtigt.
Aber nicht nur dass die USA nun Sanktionen aufheben, sie schützen darüber hinaus sogar die Einnahmen aus dem Ölgeschäft. Aus rechtlichen Gründen werden die Verkäufe über ein Konto in Qatar abgewickelt, „um den Zugriff amerikanischer Gläubiger zu verhindern und rechtliche Risiken zu umgehen.“(10). Dabei hatte Trump doch vor nicht allzu langer Zeit noch vollmundig Entschädigungen für all jene angekündigt, die unter Chavez und Maduro enteignet worden waren. Nun entzieht die amerikanische Regierung selbst diese Einnahmen der eigenen Gerichtsbarkeit durch die Abwicklung über Qatar. Wunschträume und Realität passen nicht immer zusammen.
All das geschieht vermutlich nicht aus Liebe zur Regierung in Caracas. Es kann nur vermutet werden, dass man entweder mit der venezolanischen Regierung nicht so umspringen kann, wie man sich in den USA ausgemalt und verkündet hatte. Eine andere Erklärung ist, dass bei einer Beschlagnahmung der Einnahmen aus dem Ölgeschäft durch Gläubiger die Kosten des Venezuela-Abenteuers die amerikanische Staatskasse noch mehr belasten könnten als ohnehin schon. Wenn deren Forderungen bedient würden, würde der amerikanische Steuerzahler weitgehend leer ausgehen. Das Venezuela-Abenteuer wäre dann nur zum Vorteil der Gläubiger veranstaltet worden.
Nachteil USA
Bisher konnte aber aus dem Venezuela-Einsatz nicht der lauthals in Aussicht gestellte Gewinn für die USA gezogen werden. Jedenfalls wurde bis heute nur eine einzige Transaktion bekannt gegeben im Umfang von 500 Millionen Dollar. Dabei handelte es sich um Öl, das aufgrund von Sanktionen durch die USA blockiert oder kontrolliert wurde. Dazu gehörten auch die etwa 30 bis 50 Millionen Barrel auf den von den USA festgesetzten Tankern. Es scheint also außer jenem, das ohnehin schon unter amerikanischer Verfügungsgewalt stand, noch kein neu gefördertes Öl an die USA überstellt und von diesen verkauft worden zu sein. Dabei hatte doch der US-Energieminister die Kontrolle auch über die Förderung in Venezuela übernehmen wollen.
Dass Minister Wright bisher keine Erhöhung der Förderung hatte durchsetzen können, klingt nicht nach jener Erfolgsgeschichte, die Trump nach seinem Überfall auf Venezuela den Amerikanern und Venezolanern aufgetischt hatte. Auch die Ergebnisse dieser Verkäufe selbst entsprechen nicht seinen vollmundigen Erklärungen. Bisher wurden aus diesem einzigen Verkauf 500 Millionen Dollar erlöst. Von denen waren Ende Januar 300 Millionen an ein Konto in Qatar überwiesen worden. Dieser Betrag wurde venezolanischen Banken zur Verfügung gestellt, „um ihnen den Verkauf von Dollar an venezolanische Unternehmen zu ermöglichen, die Devisen zur Bezahlung von Materialien benötigen.“(11)
Angesichts der Milliarden für den Militäreinsatz ist bisher also wenig von den großen Ankündigungen Trumps für den amerikanischen Steuerzahler herausgekommen. Der Verkauf des venezolanischen Öls durch Washington scheint bisher für Caracas von Vorteil sein, weshalb es auch bereitwillig auf diesem Gebiet mit den USA zusammen zu arbeiten scheint. Nach Rodriguez’ Worten sollen die USA „mit der Freigabe eingefrorener venezolanischer Vermögenswerte begonnen.“(12) haben. Auch von der Aufhebung weiterer Sanktionen ist die Rede, was für beide Seiten von Vorteil wäre. Venezuela bekommt sein eingefrorenes Vermögen teilweise wieder frei. Das Geld soll in medizinische Ausrüstung investiert werden, „die wir in den USA und anderen Ländern erwerben"(13 ).
Dass das Geld auf diesem Wege in die amerikanische Wirtschaft fließt und nicht weiter unter den Sanktionen brach liegt, ist auch für die USA von Vorteil. Das ist aber bisher der einzige erkennbare Nutzen, den Amerika aus der „Enthauptung“ der alten venezolanischen Regierung ziehen kann. Der Rest der großen Ankündigungen war bis jetzt nur Wunschträume. Denn selbst die restlichen 200 Millionen Dollar aus den Ölverkäufen haben die USA inzwischen sogar an Venezuela weiter gereicht. Man kann auf der finanziellen Ebene fürs Erste nur den Schluss ziehen: Außer Spesen nichts gewesen.
Begrenzte Möglichkeiten
Aber auch auf der übergeordneten politischen Ebene kann außer der Gefangennahme von Maduro und der Freilassung einiger politischer Gefangener kein Vorteil für die USA erkannt werden. Das ist zwar ein Propagandaerfolg gewesen, der bei so manchem Anhänger der MAGA-Bewegung das heroische Gefühl aufkommen lassen konnte, dass America great again ist. Aber darüber hinaus ist wenig zu verbuchen. Jedenfalls scheint Trump eine weitere Konfrontation mit der venezolanischen Übergangsregierung zu scheuen. Das setzt den Möglichkeiten Grenzen, die Kontrolle über das Land ausüben zu wollen, die er noch zu Anfang des Jahres angekündigt hatte.
Dazu kann er sich vielleicht weitere Luftschläge leisten, aber den Einsatz von Bodentruppen eher nicht, und ohne Drohung mit deren Einsatz dürfte es fraglich sein, ob er stärkeren Druck auf die Regierung in Caracas ausüben kann. Bisher jedenfalls hat die Trump-Regierung immer wieder Ausreden gefunden, weshalb weitere Angriffe auf Venezuela unnötig sind und erst recht der Einsatz von Bodentruppen. Das geschieht nicht nur zur Beruhigung der amerikanischen Bevölkerung. Vermutlich will man auch die Erkenntnis in der Öffentlichkeit vermeiden, dass einmal mehr einer von Trumps großartigen Plänen sich unter dem Druck der wirklichen Verhältnisse anders entwickelt als die Illusionen, die seine großsprecherischen Ankündigungen genährt hatten.
Auch Rodriguez will keine weiteren militärischen Übergriffe vonseiten der USA.
Denn auch begrenzte Luftschläge bringen Tod und Verderben. Dennoch dürfte sie um die politische Schwäche der Amerikaner wissen angesichts der Kriegsmüdigkeit im Lande. Wenn auch Caracas zur Zusammenarbeit mit den USA auf wirtschaftlichem Gebiet bereit zu sein scheint, soweit es den eigenen Interessen dient, so werden weitergehende politische Forderungen hingegen entschlossen zurückgewiesen. Der Widerstand gegen „Befehle aus Washington“ bezieht sich auf dessen Forderung, die Beziehungen zu China, Russland und dem Iran abzubrechen, indem „Venezuela die Diplomaten aus diesen Ländern ausweist.“ (14) Damit aber würde sich Venezuela vollkommen in die Hände der USA geben. Das wird man sicherlich zu vermeiden suchen, so lange die Möglichkeiten dazu bestehen. Zwar hatten Russland und China den Überfall auf Venezuela nicht verhindern können, aber in dieser Angelegenheit dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein.
(1) Tagesspiegel vom 27.1.2026 „Es reicht mit den Befehlen“: Maduros Nachfolgerin fordert Unabhängigkeit von Washington – und liefert dennoch Öl
(2) Web.de 28.1.2026 Rubio droht Venezuela offen mit Gewalt
(3) FAZ 31.1.2026 Caracas an der kurzen Leine
(4) FAZ 16.1.2026 Trump lobt Venezuelas Führung
(5) FAZ 31.1.2026 Caracas an der kurzen Leine
(6) Reuters 28.1.2026 Rubio verweist auf die Fortschritte Venezuelas und erklärt, die USA planten keinen weiteren Einsatz von Gewalt.
(7) Global Times vom 24.1.2026 Weißes Haus erwägt mögliche vollständige Ölblockade gegen Kuba
(8) Rüdiger Rauls: Trumps Pläne und Venezuelas Öl
(9, 10) FAZ 31.1.2026 Venezuela öffnet Ölsektor
(11) Reuters 20.1.2026 Venezuela hat 300 Millionen Dollar aus Ölverkäufen erhalten, sagt der amtierende Präsident
(12, 13, 14) Die Zeit 28.1.2026 USA wollen laut Venezuelas Übergangspräsidentin Vermögen freigeben
Rüdiger Rauls ist Reprofotograf und Buchautor. Er betreibt den Blog Politische Analyse
10:04 | Mises: Hyperinflation und monetärer Zusammenbruch
Am 20.10.2025 veröffentlichte Philipp Bagus auf unserer Website seinen Beitrag „Kreditgeld, Pesos, Dollars und Argentinien“ , der später auch auf Englisch erschien und in welchem es um die potenziellen Auswirkungen der Schließung der argentinischen Zentralbank auf den Wert des Pesos ging. Daraufhin erwiderte Jörg Guido Hülsmann mit seinem Beitrag „Closing a Central Bank: Comment on Bagus“ auf der Website des Mises Institute, Auburn (Alabama, USA), dem wiederum eine Gegenerwiderung von Philipp Bagus folgte. So entstand eine englische Artikelserie aus insgesamt 8 Beiträgen, welche die Autoren nun dankenswerterweise auf Deutsch für unsere Leser zur Verfügung stellen. In vier Doppelbeiträgen lesen Sie jeweils zuerst die Erwiderung von Jörg Guido Hülsmann und sodann die Gegenerwiderung von Philipp Bagus. Heute folgt der dritte Doppelbeitrag (den ersten finden Sie HIER, den zweiten HIER).
15:22 | Leserkommentar
Wieder dazugelernt. Weil ich nicht wusste, das Hyperinflation unter Rubik Theorien läuft. Weil ich mich z.B. noch gut z.B. an Simbabwe erinnern kann.
"Im Jahr 2008 erlebte Simbabwe die zweitschwerste Hyperinflation der Geschichte (Hanke und Krus, 2013). Wie die untenstehende Tabelle zeigt, erreichte die jährliche Inflationsrate in Simbabwe im November 2008 ihren Höchststand mit 89,7 Sextillionen (10^21) Prozent (Hanke und Kwok, 2009). Die Preise verdoppelten sich alle 24,7 Stunden..." Und "Wie kam es 2019 in Simbabwe zu einer Hyperinflation? Die Hyperinflation in Simbabwe war nicht nur ein monetäres Phänomen, sondern ein Symptom tiefgreifender wirtschaftlicher und politischer Probleme. Die Regierungspolitik, insbesondere das Landreformprogramm, führte zu einem starken Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion, was wiederum die Exporterlöse des Landes beeinträchtigte..." Und historisch gesehen, hatte Deutschland angeblich auch mal Hyperinflation. Hm, immer diese kruden Theorien von Mises? Und übriges 2019 war es plötzlich ein Phänomen.
"Was ist ein Phänomen? Phänomen n. 'sich den Sinnen zeigende oder gedachte Erscheinung, seltenes, außergewöhnliches Vorkommnis, auffallende (Natur)erscheinung, ungewöhnlicher, überragender Mensch', entlehnt (2. Hälfte 17. Jh.)..." Ja, ja, nichts ist wie scheint? Selten? "Die erschreckende Zahl gescheiterter Fiatwährungen im Laufe der Geschichte. Historische Aufzeichnungen enthüllen eine beunruhigende Wahrheit über unsere Währungssysteme: Rund 152 Fiatwährungen sind im Laufe der Geschichte aufgrund von Hyperinflation zusammengebrochen..."
12.02.2026
11:43 | Das System der Unantastbaren – Macht, Angst und das organisierte Schweigen
Was wir beim Epstein-Komplex sehen, ist kein isolierter Skandal, sondern ein System – ein geschlossener Luxus-Pervertierten-Club, der sich über Jahrzehnte eingerichtet hat wie in einer privaten Parallelgesellschaft. Oben, im klimatisierten Penthouse der Macht, entsteht ein Eliten-Selbstbedienungsladen wo alles erlaubt und alles möglich ist.
Es ist das Netzwerk der Unantastbaren – Politiker, Investoren, Stiftungsfunktionäre, Royals, Juristen. Menschen, die sich gegenseitig absichern, Deals einfädeln und im Zweifel Ermittlungen einstellen und Akten verschwinden. Ein System mit Privatisierter Straffreiheit als Geschäftsgrundlage.
Und dann wundert man sich über die Eskalation? Wenn Macht auf Enthemmung trifft, entstehen Anwaltlich betreute Abgründe. Grenzen verschieben sich. Reize stumpfen ab. Irgendwann reicht die normale Dekadenz nicht mehr. Irgend wann haben Partys unter Erwachenen ihren Reiz verloren, andere Thrills müssen her. Snuff-Filme als Abendprogramm als morbide Steigerung eines Milieus im luftleeren Raum.
Das ist der Punkt, an dem man versteht: Die Epsteins dieser Welt sind Symptome.
Denn wer jahrzehntelang erlebt, dass Deals hinter verschlossenen Türen mehr zählen als Gesetze, der internalisiert eine einfache Logik: Wem das Gericht gehört, der braucht kein Gesetz.... Und wer in alle Ebenen hinein vernetzt ist, der weiß auch: Wer alles kaufen kann, kauft irgendwann auch das Schweigen.
Und... In diesen Kreisen geht es nicht primär um Lust. Nicht um Geld. Nicht einmal um Ideologie. Die wahre Ware ist nicht Sex, nicht Geld – es ist Erpressbarkeit. Information ist Macht. Kompromat ist Kontrolle. Und Kontrolle ist Währung.
Reichtum korrumpiert nicht automatisch – aber Straflosigkeit tut es. Wenn Menschen über Jahre lernen, dass jede Krise managbar ist, jeder Staatsanwalt verhandelbar und jeder Skandal temporär, dann wächst ein Gefühl struktureller Immunität. Das System schützt sich selbst. Fällt einer, wird er isoliert. Ein schwarzes Schaf. Ein tragischer Einzelfall. Der Rest bleibt unangetastet. Wir erleben das gerade bei Ghislaine Randy Andy Epstein P. Diddy usw
Denn sie wissen: Sie fürchten nicht das Gesetz – sie fürchten nur Öffentlichkeit. Und genau darin liegt der Kern. Nicht im Einzeltäter, nicht im Boulevard, sondern in einem global verflochtenen Machtmilieu, das sich seiner eigenen Unantastbarkeit zu sicher geworden ist.
Und dann sind da die Mitwisser. Die Schattenfiguren im Hintergrund. Keine Milliardäre, keine Staatsgäste – sondern die, die den Dreck anfassen mussten. Diener. Butler. Reinigungskräfte. Sicherheitsleute. Eine Belegschaft im permanenten Gehorsam aus Existenzangst.
Jemand musste den Dreck wegräumen. Die Spuren. Die Opfer. Das, was nach Exzessen übrig bleibt, wenn oben wieder Champagnergläser klingen. Und jeder dort wusste: Wer unten arbeitet, weiß, wie weit oben der Abgrund reicht.
Denn die Insel war kein Lost Place, sie war ein Betrieb. Mit Schichtplänen. Mit Dienstanweisungen. Mit Menschen, die Dinge gesehen haben müssen, die man nicht vergisst. Und trotzdem: fast niemand redet. Warum? Weil Sie haben nicht nichts gesehen. Sie haben gelernt, nichts zu sagen.
In solchen Milieus ist Schweigen reiner Selbstschutz. Denn Schweigen ist keine Moralfrage, sondern eine Risikokalkulation. Wer glaubt, ein Angestellter könne sich locker gegen ein milliardenschweres Machtgeflecht stellen, hat keine Ahnung von realer Hierarchie. Da geht es nicht um Mut, da geht es um Überleben. Auch um das der Familie.
Es kursieren seit Jahren Gerüchte über kompromittierendes Material, über Aufnahmen von Missbrauch, sogar von extremster Gewalt – veröffentlicht wurde nichts, bewiesen ist bis jetzt also nichts. Aber allein die Drohkulisse solcher möglichen Beweise reicht, um ein Klima der Einschüchterung zu schaffen. Angst ist dort kein Nebeneffekt, sie ist Systembestandteil.
Uns wurden ein paar Bruchstücke präsentiert, gerade genug, um Empörung zu simulieren – aber wir kennen die Namen, wir kennen die Kreise, wir kennen die Mitläufer. Und trotzdem sitzt – sieben Jahre nach Epsteins Tod niemand hinter Gittern außer Ghislaine Maxwell. Das ist der ausgestreckte Mittelfinger mitten in unser aller Gesicht. Sie sagen uns: Seht her, wir sagen es euch, wir zeigen es euch – und ihr könnt nichts dagegen tun. Und wir machen weiter. Immer und immer wieder. JE
15:11 | Leserkommentar
Gelungene Zusammenfassung mit treffendem Fazit. Der aufmerksame Zeitgenosse weiß/ahnt bereits seit dem Dutronx Vorfall was für Abgründe sich da auftun und die Indizien wurden nicht weniger, z.B. die Fälle Manuel Schadwald, Maddie McCann etc. Diese ganze Gülle ist systemimmanent und dem recht und billig Denkenden erfaßt ein abgrundtiefer Ekel angesichts der Untätigkeit und Machtlosigkeit.
17:20 | Die Eule
Warum aber spricht denn niemand die Glauibensgemeinschaft jener Unantastbaren an, die ja nach eigener Überzeugung zu den Auserwählten Gottes gehören. War dies nur ihre Rache
für die Jahrhunderte dauernde Unterdrückung durch der Kirche und die Ausbeutung als willfährige Gläubiger der damaligen Herrscher? Oder war dieser Missbrauch am Ende Teil der Mission der Auserwählten, die glauben so Gottes Plan zu erfüllen? Schließlich hatte ja schon der große Jesaja einst versprochen, dass das Volk Israel beim letzten Gericht errettet wird. Wer natürlich dieses prophetische Versprechen in der Tasche hat, kann sich natürlich alles erlauben.
17:45 | Spartakuss zu 11:43 Uhr
Früher, also damals war Corona in aller Munde oder Nase, so man denn ohne Maske ungeschützt herum lief.
Leider war der Kopf und das bissel Resthirn, bei den meisten offen wie ein Scheunentor und der Virus konnte über die Informationsmüllpropaganda, ungefiltert bei sehr sehr vielen die Firewall überlisten, einfliessen und der Marionetten-Hafte-Zombie-Einfluß konnte das Handeln übernehmen.
Nun redet die alte Welt, über diesen angeblich toten Epstein und wer alles zu ihm Kontakt hatte.
Wer hat eigentlich, dass neue Gesicht für Epstein bezahlt und wer hat ihm die Papiere geMacht und mit welcher neuen Identität liegt er am Strand in der Sonne und trinkt Sex on the Beach?
Falls diese Epstein-Files mal vor Gericht landen und Schuldige gefunden werden sollen, darf man nicht außer acht lassen, dass der Epstein-Richter, mit einem neuen Gesicht, über den Ausgang dieser Geschichte urteilen könnte.
Im angeblich antiken Rom, gab es ja wohl auch schon eine gewisse Art von Pädophilie und diese sorgte schon öffentlich für Klarheit und Aufklärung, so die Geschichten und Erzählungen darüber stimmen, dass die Senatoren liebend gerne, mit kleinen Jungs gespielt haben.
Die Obelisken standen früher im alten Rom und auf der ganzen Welt, einer einheitlichen Ar(s)chitektur und heute steht der monumentale Obelisk in Washington, nicht weit vom Weißen Haus.
Das ist ein markantes okkultes phallisches Symbol und es zeigt.....Wir können mit euch alles machen was wir wollen und ALLES AUF DIE SPITZE (DES TODES) TREIBEN!.......
10:17 | Dieser Mann behauptet, das Bermuda-Dreieck gelöst zu haben. Warum glaubt ihm die Welt nicht?
Das werden Sie beim Lesen dieser Geschichte erfahren:
Ein australischer Wissenschaftler behauptet, Wahrscheinlichkeiten seien die Hauptursache für das Verschwinden von Personen im Bermuda-Dreieck.
Wenn man dann noch das unsichere Wetter und die fragwürdige Flug- und Bootsführung hinzurechnet, glaubt Karl Kruszelnicki, dass es keinen Grund gibt, an das Phänomen des Bermuda-Dreiecks zu glauben.
Während die Verschwörungstheorie des Bermuda-Dreiecks schon seit Jahrzehnten existiert, vertreten die National Oceanic and Atmospheric Association und Lloyd's of London schon seit langem dieselben Ideen.
.. kaum ist der Erich von der Erde verschwunden ... kommen solche Komiker. TS
10.02.2026
17:25 | konjunktion: Systemfrage: Befinden wir uns auf dem Weg in einen Polizeistaat?
Wäre alles nicht so ernst, müsste man fast darüber in Lachkrämpfe ausbrechen, aber was wir dieser Tage erleben, ist die Umkehrung des „Denkens“, wenn angeblich „konkurrierende“ Parteien oder wenn angeblich links gegen rechts propagiert. Es gibt einen einfachen Grund dafür, dass es zwei große „politische Strömungen“ oder überhaupt gesellschaftlich unterschiedliche Ideologien gibt, denn diese Art der gewollten Herrschaftsstruktur garantiert Massenspaltung und Hass – zwei Dinge, die notwendig sind, damit das System durch die Politik die gesamte Bevölkerung zähmen und kontrollieren kann. Nie zuvor war dies so offensichtlich wie heute.
Die konservative oder rechte Seite neigt angeblich eher zum Kapitalismus, zu Waffenrechten, Krieg und gegen Bürgerrechte, aber das ist natürlich alles eine Farce. Die linke Seite steht angeblich für Bürgerrechte, Sozialhilfe, Waffenbeschlagnahmung und gegen Krieg, aber auch das ist alles eine Farce. Beide Seiten akzeptieren fast alles, solange ihr politischer „Retter“ an der Macht ist. Aktuell hat das eher rechte Lager in den USA ihren „Retter“ im Weißen Haus setzen und baut gerade einen massiven Polizeistaat, Massenüberwachung, extreme Zensur und Krieg auf. Parallel stimmen die Linken in einigen Dingen dieser Politik zu, anderes wird abgelehnt, Proteste und Unruhen werden gezielt ausgelöst, aber in immer mehr Kernpositionen findet eine Umkehrung statt. Insbesondere die Waffenfrage hat sich nun umgekehrt, da Trump gesagt hat, keine Waffen mehr, keine Waffen auf der Straße, während die Linke aufgrund der ICE-Vorfälle und der Brutalität nun für Waffen ist. Das kann man sich nicht ausdenken.
Der entscheidende Punkt ist weniger, wer gerade regiert, sondern welche institutionellen Grenzen und Kontrollmechanismen funktionieren. Wo Schulden steigen, Sicherheitsapparate wachsen und technologische Überwachung billiger wird, verschiebt sich das Kräfteverhältnis automatisch zugunsten des Staates.
Die eigentliche Frage für Bürger und Märkte lautet also nicht „links oder rechts“, sondern: Bleiben Rechtsstaat, Gewaltenteilung und Transparenz stark genug, um diese Expansion wieder einzufangen? JE
14:33 | transition: «Die Eliten haben sich selbst delegitimiert»
Transition News: «Wir befinden uns mitten in einem Bruch, nicht in einer Übergangsphase», erklärte der kanadische Premierminister Mark Carney Ende Januar in Davos. Wie stellt sich dieser Bruch aus deutscher Perspektive derzeit dar? Anselm Lenz: Der Bruch zeigt sich darin, dass politische und wirtschaftliche Eliten weltweit Demokratie, Grundrechte und Verfassungen offen zugunsten abgeschotteter Machtstrukturen zerstören. Seit 2020 wird dieser autoritäre Umbau propagandistisch überdeckt – mit Berufung auf «Die Wissenschaft», Expertentum als Herrschaftsinstrument und einer angeblich «grünen» Moderation massiver Verarmung. Begriffe wie «Ressourcenschonung» oder «Wassersparen» dienen dabei real der Privatisierung und Verteuerung elementarer Lebensgrundlagen.
Bei einer «deutschen Perspektive» nehme ich selbstverständlich die der Arbeiter, Arbeitslosen, Angestellten, der Eltern, der kleinen und mittleren Unternehmer, der Scheinselbständigen und Abgeschafften, der Menschen, die versuchen, hier noch ihre Kinder großzuziehen und so weiter ein. Aus Sicht dieser Menschen in Deutschland haben sich weite Teile des BRD-Staates delegitimiert. Ja, die Eliten haben sich selbst delegitimiert.
Der Lack ist ab — und darunter kommt nichts Elegantes zum Vorschein JE
09.02.2026
08:45 | mises: Milei-Konferenz 2026. Sind libertäre Reformen auch in Deutschland umsetzbar?
Ludwig von Mises Institut Deutschland (LvMID): Liebe Frau Petry, am 14. März 2026 findet in Leipzig die „Milei-Konferenz 2026“ statt. Es geht offensichtlich darum, Präsident Javier Mileis legendäre Kettensäge auch in Deutschland zum Einsatz zu bringen. Können Sie unseren Lesern bitte erklären, um was es bei der Konferenz genauer geht?
Frauke Petry (FP): Deutschland braucht einen konkreten Deregulierungsplan. Wir bringen in Leipzig namhafte Persönlichkeiten auf die Bühne, die konkret erklären werden, wie diese Deregulierung in Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren wird.
LvMID: Können Sie unseren Lesern einige Beispiele geben? Wo würden Sie die Kettensäge zuerst ansetzen?
FP: Man kann auf mehrere Weisen beginnen. Eine Baustelle, die nichts kostet und politisch leicht durchsetzbar wäre, sind die unendlichen Berichts- und Statistikpflichten für Unternehmen. Längerfristig aber noch viel wirkungsvoller wäre eine Liberalisierung des Energiemarktes und die Wiederzulassung von Kernkraft. Politisch sehr kompliziert, aber mit enormen Potentialen für Motivation von Arbeitnehmern und Unternehmern wäre die Simplifizierung des Steuersystems und eine Rückführung auf wenige einfache Steuerarten. Und dann wäre da noch der „Sozialstaat“ …
10:05 | Leser Kommentar
zu 08:45 .... komisch, keine Spur einer Diskussion über eine Spekulatiossteuer, bzw -Umstazsteuer! Vor Jahren war dies mal kurz ein Thema. Nun, mit wenigen Zentel-Prozent bei Einkauf und Verkauf von Wertpapieren (Bankenhanden natürlich eingeschlossen!!), könnte man die Sozialversicherung massiv entlasten. Damit auch die Arbeitsnebenkosten deutlich senken. Etwas, was wir dringend bräuchten! Man muss zugeben, dass sich das Finanzkapital an den Sozialkosten nicht beteilit (wäre auch selber betroffen)
05.02.2026
18:36 | manova: Von Grönland bis zum Mars
Der öffentliche Raum gehört allen. Die Plebs kann ihn ebenso betreten wie der reichste Mann der Welt. Und genau das ist es, was bestimmte „Eliten“ nicht mehr länger hinnehmen wollen. Gesetze, die nicht von ihnen selbst, sondern von gewählten Vertretern der Majorität bestimmt werden, der Zwang zur Rücksichtnahme auf das Gemeinwohl, Umverteilung zugunsten der Schwächeren: Schnee von gestern. Elitär sein bedeutet, Unwürdige ausschließen, ja aussperren zu können. Reichen-Ghettos, „Gated Communities“ haben es vorgemacht. Der Trend der Zukunft heißt: ein Staat von Reichen, für Reiche, nach den Regeln von Reichen. Dazu ist es nicht einmal mehr notwendig, dass ein Staatsgebilde an ein geografisches Territorium gebunden ist. Es kann sich auch um ein überwiegend virtuelles Konstrukt handeln. Da man gewöhnliche Menschen ohnehin eher verachtet, bieten sich auch weitgehend menschenleere Gebiete wie das derzeit umkämpfte Grönland als neue Wohnstatt an. Oder man muss in den Weltraum ausweichen, wo soziale Apartheid ungestört praktiziert werden könnte.
Kommentar des Einsenders
Die Feudalherrscher des Techno-Faschismus formieren sich.
Enteignung von Demokratie nennen wir jetzt „Innovation“. Während der normale Bürger über Heizkosten diskutiert, planen Milliardäre schon die nächste Version des Feudalismus – diesmal mit KI, Drohnen und CEO-König. Früher hieß es Adel und Leibeigene. Heute heißt es Investoren und Nutzer....
Grönland wird vorbereitet – als Spielwiese für Tech-Oligarchen, die keinen Bock mehr auf Wahlen, Steuern und lästige Menschen haben. Also... Nicht der Staat stirbt. Er wird gerade aufgekauft. JE
04.02.2026
14:12 | voltairenet: Balkanisierung des Westens: Die "5 Abendländer" des russischen Geostrategen Aleksander Dugin
Der berühmte russische Philosoph und Geostratege Alexander Dugin – Ideologe des relevanten Konzepts des Neo-Eurasianismus und Autor der "Vierten politischen Theorie" – hat seine Götzenverehrung von Präsident Trump begraben, dem er erst vor einem Jahr sogar ein Lob widmete: Trumps Revolution: Die neue Ordnung der Großmächte [1].
Es gibt einen weit verbreiteten Mythos, laut dem Alexander Dugin, 64, "Putins Gehirn" sei, was ein Unsinn ist, da der russische Präsident neben seiner Erfahrung im ehemaligen sowjetischen KGB auch einen Doktortitel in Rechtswissenschaften hat und man ihm nicht die Hand beim Schwimmen geben muss.
Kommentar des Einsenders
Alexander Dugin analysiert den Zerfall des Westens neu. Interessante Perspektiven.
Was Dugin da beschreibt, ist ein westlicher Selbstzerlegungsprozess in Zeitlupe. Trump als Imperator, Europa als kastrierter Statist, London auf Alleingang, die Globalisten im Dauerkrieg gegen ihre eigenen Völker und Israel als permanenter Brandbeschleuniger im Hintergrund. Der Westen streitet sich nicht mehr mit Russland, er führt längst Bürgerkrieg gegen sich selbst...
Und während in Washington, Brüssel und London noch Debatten über Gendersternchen laufen, sortieren sich die Großmächte neu. Das ist wie bei der Titanic: Oben spielt die Kapelle Demokratie und Werteordnung, unten läuft schon das Wasser rein. Nur diesmal gibts keine Rettungsboote. JE